Ein Impuls für Führungskräfte, die Entwicklung wirklich wollen.
Probleme gehören zum Alltag jeder Führungskraft. Sie tauchen überall auf – in Prozessen, Beziehungen, Entscheidungen. Manche Probleme sind komplex, andere eher alltäglich. Manche lösen sich von selbst, andere begleiten uns über Jahre.
Doch manchmal entsteht der Eindruck, dass bestimmte Probleme einfach nicht verschwinden wollen. Trotz Workshops, Gesprächen und Strategien bleiben sie bestehen – fast so, als hätten sie ein Eigenleben.
Die provokante Frage lautet:
Könnte es sein, dass wir unsere Probleme – zumindest unbewusst – lieben?
1. Die paradoxe Beziehung zum Problem
Menschen definieren sich nicht nur über ihre Erfolge, sondern auch über ihre Schwierigkeiten. Ein Problem gibt Struktur, Richtung und – oft unbemerkt – Bedeutung.
Das klingt absurd, aber es ist psychologisch hochlogisch:
Ein Problem ist nicht nur Belastung, es ist auch Bindung.
Viele Führungskräfte, mit denen ich arbeite, berichten von Situationen, in denen sie „eigentlich wissen, was zu tun wäre“, aber trotzdem nichts ändert.
Warum? Weil das Problem einen Nutzen erfüllt – einen verdeckten, emotionalen oder systemischen.
Beispiel:
Ein Team klagt seit Jahren über zu viele Meetings. Niemand ist zufrieden – doch gleichzeitig bietet jedes Meeting eine Bühne, ein Gefühl von Wichtigkeit, eine Routine.
Das Problem stört – aber es stabilisiert auch.
Jedes ungelöste Problem erfüllt eine Funktion.
Solange diese Funktion unbewusst bleibt, bleibt das Problem bestehen.
2. Probleme schaffen Bedeutung und Identität
Ein Problem erzählt eine Geschichte – und diese Geschichte gibt Sinn.
„Ich kämpfe für Qualität.“
„Ich halte den Laden zusammen.“
„Ich bin die Einzige, die sich kümmert.“
Solche inneren Narrative geben Menschen Orientierung. Das Problem wird zum Dreh- und Angelpunkt der eigenen Identität.
Für Führungskräfte bedeutet das:
Manchmal braucht jemand sein Problem, um seine Rolle zu verstehen.
Die Kollegin, die ständig über mangelnde Kommunikation klagt, hat in dieser Klage eine Funktion gefunden: Sie sorgt für Verbindung.
Der Mitarbeiter, der sich immer über die IT beschwert, erlebt sich als Realist, der den Finger in die Wunde legt.
Das Problem wird zum emotionalen Zuhause – unbequem, aber vertraut.
3. Probleme schützen vor Veränderung
Veränderung verlangt Mut, Energie und Ungewissheit.
Ein bestehendes Problem, so unangenehm es ist, hat einen entscheidenden Vorteil: Man kennt es.
Psychologisch betrachtet ist das bekannte Leid oft leichter auszuhalten als das unbekannte Glück.
Das Gehirn liebt Vorhersehbarkeit – und Probleme liefern genau das.
Wenn eine Führungskraft z. B. immer wieder betont, dass ihr Team „einfach nicht mitzieht“, bleibt die Verantwortung klar verteilt: Ich will, aber die anderen tun nicht.
Das schützt vor der unbequemen Selbstreflexion: Was in meiner Führung könnte dazu beitragen?
In diesem Moment ist das Problem nicht nur eine Hürde – es ist auch ein Schutzschild.
Es hält die Illusion aufrecht, Kontrolle zu haben, ohne etwas verändern zu müssen.
4. Probleme verbinden – und trennen zugleich
In Teams sind Probleme häufig sozialer Kitt.
Gemeinsames Jammern schafft Gemeinschaft. Wer dieselbe Last teilt, fühlt sich verstanden.
Dieses „Wir gegen die Umstände“-Gefühl ist stark – aber trügerisch.
Denn es bindet Energie an das Vergangene und verhindert kollektive Entwicklung.
Ein Team, das sich ständig über zu hohe Arbeitslast beklagt, entwickelt eine geteilte Identität als Opfer der Umstände.
Doch damit verliert es Gestaltungskraft.
Die gemeinsame Problem-Liebe schafft Zugehörigkeit – aber sie verhindert Bewegung.
Führung bedeutet, diesen Kreislauf zu erkennen und zu unterbrechen.
Nicht, indem man das Problem abwertet, sondern indem man den Sinn dahinter sichtbar macht: Was hält uns an diesem Muster fest?
5. Probleme geben Kontrolle – Lösungen erzeugen Unsicherheit
Paradoxerweise kann ein ungelöstes Problem auch Sicherheit bieten.
Es ist bekannt, berechenbar und kontrollierbar. Eine Lösung dagegen öffnet eine neue Realität – mit neuen Erwartungen, neuen Risiken, neuen Anforderungen.
Wer sein Problem löst, verliert etwas:
Das Bekannte, das Vertraute, manchmal sogar eine ganze Identität.
Ein Beispiel:
Eine Führungskraft, die jahrelang als „Feuerwehrfrau“ bekannt war, wird plötzlich in eine ruhigere, strategische Rolle befördert.
Das klingt positiv – doch innerlich entsteht Leere.
Ohne tägliche Krisen fehlt das Gefühl, gebraucht zu werden.
Das alte Problem war belastend, ja – aber auch identitätsstiftend.
So gesehen, ist es verständlich, warum manche Menschen ihre Probleme lieben:
Sie halten sie am Leben, weil sie sich über sie lebendig fühlen.
6. Der blinde Fleck der Führung
Führungskräfte stehen besonders im Spannungsfeld zwischen Problemdruck und Lösungserwartung.
Oft wird von ihnen erwartet, dass sie Probleme lösen. Doch in Wahrheit besteht ihre tiefere Aufgabe darin, das System hinter dem Problem zu verstehen.
Denn Probleme sind selten isoliert. Sie sind Ausdruck von Strukturen, Kommunikationsmustern und unausgesprochenen Bedürfnissen.
Eine erfahrene Führungskraft erkennt:
- Wo Widerstand ist, steckt oft ein unerfülltes Bedürfnis.
- Wo sich ein Problem wiederholt, wirkt ein stabilisierendes Muster.
- Wo Klagen laut werden, ist oft Bindung versteckt.
Führung bedeutet, diese Dynamiken sichtbar zu machen – und das System zu bewegen, statt nur Symptome zu behandeln.
7. Der Weg aus der Problem-Liebe
Wie gelingt es, sich von der Bindung an Probleme zu lösen?
Nicht durch Druck, sondern durch Bewusstheit.
Schritt 1: Selbstbeobachtung
Erkenne, wo du selbst an einem Problem hängst.
Frage dich:
- Was gibt mir dieses Problem?
- Welche Funktion erfüllt es für mich oder mein Team?
- Was würde geschehen, wenn es wirklich gelöst wäre?
Diese Fragen öffnen einen Raum, in dem Entwicklung möglich wird.
Schritt 2: Neuinterpretation
Statt Probleme als Hindernisse zu sehen, betrachte sie als Signale.
Ein Problem zeigt, wo Energie fließt – und wo Potenzial verborgen liegt.
Es ist kein Gegner, sondern ein Spiegel.
Führungskräfte, die so denken, verändern ihre Organisation von innen heraus.
Sie fragen nicht: Wie bekomme ich das weg?, sondern: Was will sich hier zeigen?
Schritt 3: Verantwortung übernehmen
Echte Entwicklung beginnt mit Verantwortung.
Nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von Gestaltungsmacht.
Wenn ich ein Problem als mein Spielfeld begreife, gewinne ich Einfluss zurück.
Verantwortung heißt: Ich bin bereit, die Komfortzone zu verlassen und neue Möglichkeiten zuzulassen.
Schritt 4: Den emotionalen Gewinn loslassen
Jedes Problem bietet einen inneren Vorteil – Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Sicherheit.
Sich davon zu lösen, erfordert Mut.
Doch genau dort beginnt Führung im eigentlichen Sinne: in der Fähigkeit, emotionale Muster bewusst zu überschreiten.
8. Vom Problemdenken zur Gestaltungsenergie
Organisationen, die sich im Problemdenken verfangen, verlieren Innovationskraft.
Teams, die ständig über Defizite sprechen, erzeugen Defizitenergie.
Führungskräfte, die dagegen Entwicklungskultur schaffen, richten den Fokus anders: auf Sinn, auf Verantwortung, auf Potenzial.
Das heißt nicht, Probleme zu verdrängen. Im Gegenteil:
Es bedeutet, sie wertzuschätzen – aber nicht zu verehren.
Ein gesunder Umgang mit Problemen ist geprägt von Neugier, nicht von Anhaftung.
Statt „Wie schlimm ist das?“ lautet die Führungsfrage:
„Was will sich hier verändern – durch mich?“
9. Fazit: Die Kunst, Probleme loszulassen
Menschen lieben ihre Probleme, weil sie ihnen Struktur, Zugehörigkeit und Sicherheit geben.
Doch echte Führung entsteht dort, wo man diese emotionale Bindung erkennt – und den Mut findet, sie zu lösen.
Führungskräfte, die das verstehen, führen anders.
Sie hören nicht nur auf die Klagen ihrer Mitarbeitenden, sondern auf das System dahinter.
Sie wissen: Jedes Problem erzählt eine Geschichte – und jede Geschichte kann neu geschrieben werden.
Wahre Führung bedeutet, das Drama des Problems zu beenden und die Energie in Entwicklung zu verwandeln.
Denn erst, wenn wir aufhören, unsere Probleme zu lieben, beginnen wir, unsere Möglichkeiten zu leben.
Impulse für Ihre Praxis
- Beobachten Sie Ihr Team: Welche Probleme kehren immer wieder?
- Fragen Sie: Welche Funktion könnte dieses Problem im System haben?
- Machen Sie sichtbar, was dadurch stabilisiert wird – und was verhindert wird.
- Ermutigen Sie Ihr Team, nicht über Probleme, sondern über Einflussmöglichkeiten zu sprechen.
- Führen Sie Gespräche über Sinn, nicht nur über Symptome.
Autor: Günter Schobesberger
Unternehmensberater für Organisationsentwicklung und Personalentwicklung.
Ich begleite Führungskräfte dabei, Dynamiken zu erkennen, Potenziale freizusetzen und Kultur zu gestalten, die Entwicklung möglich macht.

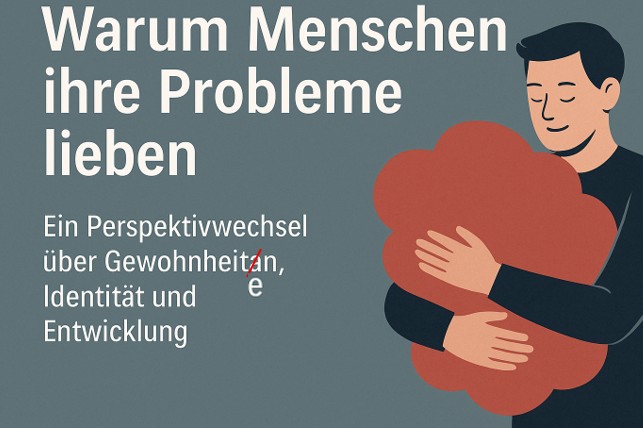
Comments are closed